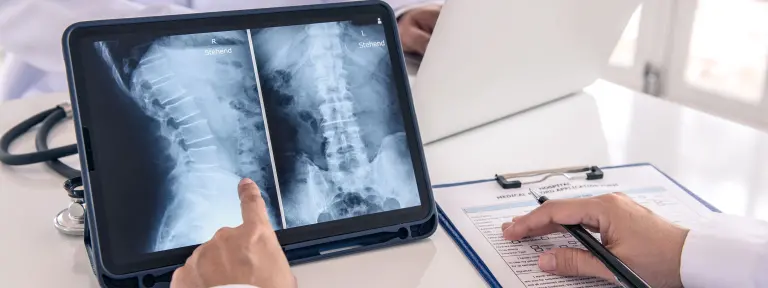Stellen Sie sich vor, Sie könnten wegen einer Krankheit oder eines Unfalls plötzlich nicht mehr arbeiten - nicht nur für ein paar Wochen, sondern vielleicht für ein halbes Jahr oder länger. Zwar erhalten Sie während dieser Zeit Krankengeld aus der gesetzlichen Krankenversicherung, jedoch begrenzt auf 78 Wochen. Danach greifen nur noch soziale Sicherungssysteme wie beispielsweise die Erwerbsminderungsrente.
Genau hier kommt die Berufsunfähigkeitsversicherung als private Vorsorge ins Spiel. Sie zahlt Ihnen eine monatliche Rente, wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen Ihren Beruf für mindestens 6 Monate zu mindestens 50 % nicht mehr ausüben können. Diese Rente kann Ihnen helfen, weiterhin Ihre Rechnungen zu bezahlen und Ihren Lebensstandard zu halten, auch wenn Sie nicht mehr arbeiten können.
Warum ist das so wichtig?
Viele denken, dass sie von staatlicher Seite aus abgesichert sind. Doch die Wahrheit ist: Die sogenannte Erwerbsminderungsrente reicht oft nicht aus, um den gewohnten Lebensstandard zu halten. Außerdem haben gerade junge Menschen, die noch nicht oder erst kurz im Berufsleben stehen, nur unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente. Daher ist es wichtig, selbst vorzusorgen.
Je früher Sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, desto besser. Denn der Beitrag richtet sich neben der beruflichen Tätigkeit unter anderem auch danach, in welchem Alter Sie die Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen haben und wie Ihr Gesundheitszustand zu dieser Zeit war.
Voraussetzungen für Berufsunfähigkeit
Wenn Sie wegen Krankheit, Unfall oder Kräfteverfall Ihrem letzten Beruf nur noch zu max. 50 % nachgehen können, gelten Sie in der Regel als berufsunfähig. Sie können eine Rente wegen Berufsunfähigkeit beantragen, wenn Sie voraussichtlich mind. 6 Monate ununterbrochen berufsunfähig sein werden oder es bereits 6 Monate lang waren.